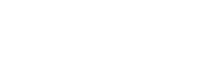Preisanfrage abschicken
Wenn Sie Interesse am Kauf dieses Kunstobjektes haben, schicken Sie uns bitte eine E-Mail oder fĂĽllen Sie unser Online-Formular aus:
Kaum jemand aus der Kadertruppe der klassischen Moderne, der vertrauter schiene als Marc Chagall. Geboren 1887, hochbetagt verstorben 1985, hat er das Jahrhundert am ureigenen Leib erlebt und es mit seinen Bildwelten begleitet. Hineingeboren als Moshe Segal in die Zeitlosigkeit des ostjüdischen „Shtetl“, ist er 1910 brüsk nach Paris hinübergewechselt, und fortan war er Marc Chagall. Er war Zeitzeuge der russischen Revolution in Sankt Petersburg und des Beginns der Sowjetunion in Moskau, er erlebte die deutsche Hyperinflation hautnah in Berlin, machte die wilden 1920er wieder in Paris mit und entkam dem Nationalsozialismus in New York. Als es ruhiger wurde, denn auch solche Phasen kennt das schrecklichste aller Jahrhunderte, schuf er, in Ehren Kunstgeschichte weiterschreibend wie so viele seiner Kombattanten der Avantgarde, sein Spätwerk an der Côte d’Azur.
In diesem gewissermaßen finalen Milieu entstand um 1960 das vorliegende Blatt. Kaum eines aus seinem weitgespannten Œuvre, das vertrauter schiene. Vor blauem, man möchte sagen: azurnem Fond, wird ein Liebespaar belauscht, jung, innig, zeitlos. Es lagert unter einem Baum, zu dessen dörflicher Anmutung sich eine Bäuerin fügt, und auch einige Ziegen dürfen nicht fehlen. Es ist das Personal, das Chagall unverwechselbar macht. Es sieht aus, als wäre alles gesagt, was zu sagen ist - und das von einem Künstler, der alles erlebt hat, was es zu erleben gab. Das Idyll, das hier waltet, ist in der Tat von perfekter Eigensinnigkeit. In seinen autobiografischen Schilderungen „Mein Leben“ schildert Chagall eine Begegnung mit seiner geliebten und im Jahr 1915 dann geheirateten Bella (die 1944 allzu früh verstorben ist): „Ich öffnete nur mein Zimmerfenster, und schon strömten Himmelblau, Liebe und Blumen mit ihr herein.“1) Diese Atmosphäre ist es, die noch die vorliegende Gouache aufgesogen hat.
Es ist die Welt seiner rustikalen Herkunft. Die indes gibt es nur in der Erinnerung, denn die Nazis haben sie ausgelöscht. So ist diese Welt des Ostjudentums alles andere als zeitlos, und so ist das Stück Kunst, das sie festhält, immer mehr als Eskapismus. Das Blatt ist nicht naiv, es tut bestenfalls so, denn niedergeschlagen hat sich alles Wissen um die menschlichen Abgründe. Marc Chagall wird heute wiederentdeckt als früher Vertreter eines Back-to-the-Roots, für das man mittlerweile den Begriff „Outsider Art“ parat hat. Doch womöglich ist das Außenseitertum, mit dem man ihn in Verbindung bringt, die Standarderfahrung des Jahrhunderts.
1) Marc Chagall, Mein Leben, Stuttgart 1959, S. 120
Rainer Metzger