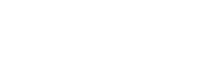Preisanfrage abschicken
Wenn Sie Interesse am Kauf dieses Kunstobjektes haben, schicken Sie uns bitte eine E-Mail oder fĂĽllen Sie unser Online-Formular aus:
In der Suche nach der absoluten Form, dem non finito, wie es Josef Pillhofer ausdrückte, erwies sich der Kopf als ideales Thema und findet sich bereits in seinem Frühwerk. Die Auseinandersetzung Pillhofers mit den formalen Möglichkeiten der Skulptur von der französischen Moderne bis zum Studium antiker Statuen während seines Romstipendiums 1957, führten letztlich zu einer Formensprache die ein breites Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten offen ließ. Keineswegs waren Pillhofers Skulpturen immer radikal reduktiv. Doch gerade in dieser Ambivalenz zwischen Figurativem und weitgehender Reduktion der Form zeigt sich sein Streben, nicht mehr das Abbildende oder Repräsentative der Skulptur zu betonten, sondern das Exemplarische zu überwinden und zu einer Verdichtung und Vertiefung der Form zu kommen. Wie auch der Kopf von 1986 zeigt, war Pillhofer im Gegensatz zu seinen Lehrern Fritz Wotruba und Ossip Zadkine nicht an der Addition einzelner, tektonischer Teilblöcke interessiert, sondern an einer analytischen Auffächerung der Volumina innerhalb einer geschlossenen Form. Im Grunde wurde die Komposition des Kopfes von 1986 bereits in den frühen 1960er-Jahren formuliert und von Pillhofer in den folgenden Jahren variiert und in ihren vielfältigen Möglichkeiten ausformuliert. Der Kopf von 1986 ist massiv und einheitlicher als andere, wesentlich stärker aufgefächerte Kopfformen des Künstlers. Das Modell für das Werk wurde in Stein gearbeitet, von dem dann ein Gipsmodel für den Guss geformt wurde. Metall war eines der bevorzugten Materialen des Künstlers. Er schätzte daran die eigenständige, ästhetische Wirkung der polierten Oberfläche, die er wirkungsvoll einzusetzen wusste.